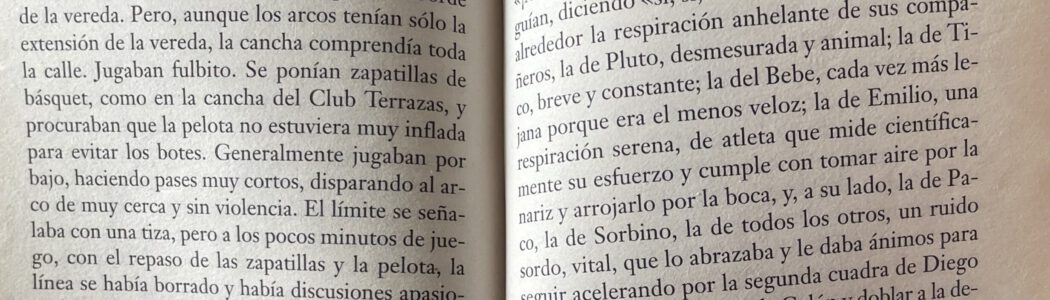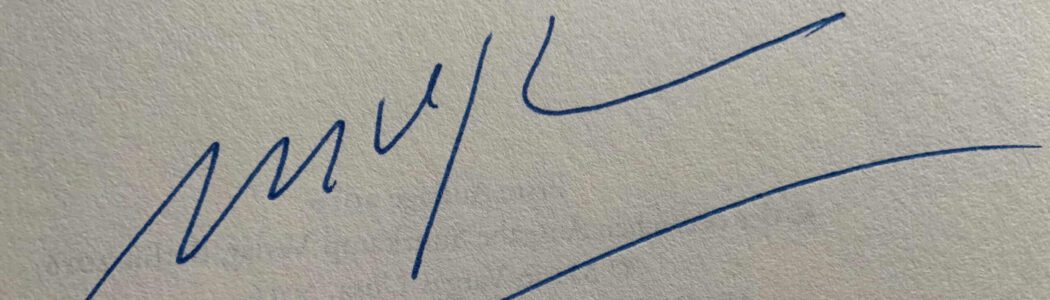Er wollte eine Geschichte über ein Charakteristikum der Fujimori-Diktatur schreiben, sagte Mario Vargas Llosa bei der Buchvorstellung in Madrid, und dieses sei, dass der peruanische Machthaber Fujimori und sein Geheimdienstchef Montesinos die Boulevardpresse benutzten, um ihre Kritiker zum Schweigen zu bringen oder zu bestrafen. Dem Leser begegnet diese Form oder vielmehr Deformation des Journalismus in der Gestalt Rolando Garro, dem Herausgeber eines Skandalblatts, das sich darauf spezialisiert hat, Prominenten aus dem Showgeschäft durch Schmähartikel und entstellende Aufnahmen zu schaden.
Rolandos neuestes Opfer ist aber kein Unterhaltungskünstler, sondern der leitende Ingenieur eines Bergbauunternehmens, Enrique Cárdenas, den er mit kompromittierenden Fotos zu erpressen versucht. Die Geschichte entwickelt sich wie ein Krimi, mit Montesinos im Hintergrund. Erzählerisch spielt Vargas Llosa dabei seine Gaben und Raffinessen (man könnte auch beanstanden: seine Routine) aus, wie eine farbige, Lokalkolorit tragende Sprache oder die kontrast- und beziehungsreiche Verschränkung von Szenen.
Rolandos Heft nennt sich Destapes, zu deutsch Enthüllungen. Das spanische Original heißt „Cinco Esquinas“ und setzt damit einen anderen Akzent. Es ist der Name einer Altstadt-Gegend in Lima, der wiederum von einer Kreuzung mit fünfStraßenecken herrührt. Der Erzähler beschreibt das Viertel als ein verzweigtes Labyrinth, das Herz der Barrios Altos, das früher voll von Kreolen, Bohemiens, Künstlern, Musikern war und Liebhaberkreolischer Musik, sogar Weiße aus Miraflores und San Isidro, anlockte, um die besten Sänger, Gitarristen und Cajón-Trommler zuhören und mit Mischlingen und Schwarzen zu tanzen. – Heute ist das Viertel heruntergekommen und seine Straßen sind gefährlich. (…) Die alten Kolonialhäuser scheinen kurz davor zu zerbröckeln.

In diesem Quartier lebte und wirkte bis in die 1930er Jahre der Tanzkomponist Felipe Pinglo, berühmt unter anderem für sein Stück „El Plebeyo“. Vargas Llosa lässt ihn in den Sehnsüchten der Romanfigur Juan Peinata aufleben: Seine grenzenlose Liebe und Bewunderung für Felipe Pinglo hatte er von seinem Vater geerbt, derjenen gekannt und bei Straßenmusik erlebt hatte, diesen Barden, der mit seinen Kompositionen die kreolische Musik in Höhen gehoben hatte, die weder der Walzer, noch die Polka, die Marinera oder der Tondero jemals zuvor oder danach erreichten.
Juan Peinata hatte in seinen besseren Jahren als Rezitator Pinglos Verse öffentlich vorgetragen. Schon diese Reproduktion bedeutete kein originelles Künstlertum mehr (weshalb er es zurückwies, wenn ihn jemand einen Dichter nannte). Doch Juan fällt noch tiefer: Aus Geldnot verdingt er sich als Clown in einem Fernsehsender und lässt es dabei zu, dass seine Liebe zur Poesie verspottet wird. Damit nicht genug, bringt ihn eine Kampagne aus Rolandos Feder um diesen Broterwerb. Als traurigem altersschwachem Mann bleibt ihm, gelegentlich von seiner Armenherberge im Zentrum Limas zu dem Schauplatz früherer Glanzzeiten zu spazieren.
Mit dem Altstadtquartier Cinco Esquinas verbindet sich also eine Verfallsgeschichte und zugleich das politisch-publizistische Themades Romans: Denn auch der Boulevardblattmacher Rolando Garro stammt aus diesem Stadtteil, seine wichtigste Mitarbeiterin wohnt dort, und er wird daselbst sein Ende finden. Sein Schmierenjournalismus wird auf diese Weise mit dem Niedergang im Inneren der peruanischen Hauptstadt in Zusammenhang gebracht.
So erhält der Roman, neben seiner politischen Stoßrichtung undseiner kriminalistischen Spannung, einen melancholischen, kulturpessimistischen Zug. An diesem Eindruck ändert auch die in die Haupthandlung eingeflochtene erotische Geschichte nichts: eine Affäreim familiären Umfeld des erpressten Geschäftsmanns Enrique, mit der das Buch beginnt und die unheilvoll auszugehen droht.
Dass Vargas Llosa, der am heutigen Ostermontag seinen 80. Geburtstag feiert, mit Skepsis und kultureller Wehmut auf sein Landund die westliche Welt blickt, überrascht nicht. Eine solche Sicht vermitteln schon sein vor drei Jahren veröffentlichter Essayband „Alles Boulevard“ und frühere Romane. Bezogen auf Peru erscheinen dabei nicht erst die Fujimori-Ära oder die Wirren seit den späten 80er Jahren mit Hyperinflation, Linksterrorismus und Militäreinsätzen gegen die Bevölkerung als der Beginn des Abstiegs. Bereits in der 1977 erschienen Romanautobiographie „Tante Julia und der Kunstschreiber“ kommt die Degeneration des Journalismus in Peru zum Ausdruck. Vargas Llosa jobbte in jungen Jahren selbst als Redakteur – eine der wenigen Übereinstimmungen mit seinem ungeliebten Vater, der fiktionale Literatur ablehnte (und dadurch den jungen Mario darin bestärkte, sich dieser zuzuwenden), aber der schreibenden Zunft insofern angehörte, als er in einer Nachrichtenagentur tätig war. Der Roman spiegelt humorig Marios Redaktionserfahrungen in den 50er Jahren wider, bevor der Erzähler das gesunkene Niveau in den 70er Jahren beklagt.
Im ebenfalls autobiographisch ausgerichteten Roman „Das böse Mädchen“ (2006), der die Epoche von 1950 bis in die Gegenwart umfasst, wird ausgesprochen, dass sich die Lage in Peru seit dem Militärputsch von Velasco Alvarado 1968 fundamental verschlechtert hat. Vargas Llosa entwirft in seinem neuesten Werk nun noch einmal ein idyllisches Bild aus der Zeit davor. Luciano, ein ehrbarer Rechtsanwalt und enger Freund Enriques, erzählt von seiner Kindheitin Ica: Der Vater seiner Mutter habe mehrere Haziendas besessen, die der Familie später durch Velascos Landreform genommen wurden, und sei sehr fromm gewesen. Täglich suchte er im schwarzen Anzug die Hauskapelle auf. Luciano und seine Brüder erlebten dort eine Kindheit, die glücklicher nicht hätte sein können: Sie ritten auf Pferden, gingen auf Jagd, badeten im Meer und der Großvater las ihnen Abenteuergeschichten von Salgari, Verne und Dumas vor. Die Großmutter war chinesischer Abstammung und kam aus schlichten Verhältnissen. Dass ein Gutsherr sie – über alle sozialen undethnischen Grenzen hinweg – geheiratet hatte, muss große Liebegewesen sein. Auch die so arrivierte Großmutter durchbrach Schranken, indem sie ungeachtet ihrer hohen Stellung bei den Festenzum Nationalfeiertag mit den Landarbeitern tanzte. Wie in der obigen Passage zum Musikerviertel scheint hier die Überwindung der gesellschaftlichen Ungleichheit im ästhetischen Erleben auf.
Dennoch gestaltet Vargas Llosa keine reine Nostalgie, denn der Geschichte vom Aufstieg des armen Mädchens zur Landadeligen verpasster eine Kehrseite: Einmal im Jahr, so erzählt Luciano weiter, unternahm die Großmutter eine geheimnisvolle Reise. Offiziell hieß es, dass sie ihre Eltern und Geschwister besucht. Die nichtstandesgemäßen Angehörigen mussten nämlich in die Ferne ziehen, weil die von der Liebesheirat ausgehende Legitimation für sie nicht galt. Der Ort, wohin sie geschickt wurden, war unbekannt. Womöglich wurden sie ermordet, und die jährlichen Reisen der Großmutterführten zu den Gräbern.
Trotz der Melancholie ist die Position, die bei Vargas Llosa durchschimmert, also keine einseitige Bejahung der Vergangenheit. Zum Bild gehört auch, dass der Autor von Cinco Esquinas die Boulevardjournalisten in seinem Roman schließlich mit der Fähigkeitzur Selbstkritik und sogar zur politischen Befreiung ausstattet. Dasist der Optimismus eines Liberalen. Mit Blick auf das Altstadtviertel erläuterte der Schriftsteller bei der Buchpräsentation außerdem, dass dieses eine Verfallsperiode hinter sich hatte, bevor es im 19. und frühen 20. Jahrhundert zum Künstlerbiotop aufblühte – welches es heute wiederum nicht mehr ist. Insofern ist das Quartier ein Symbol nicht für eine lineare Dekadenz, sondern für den Wechsel von Auf- und Abstiegen. Überhaupt gibt sich der hochbetagte Literaturnobelpreisträger unverdrossen: Im Interview mit der spanischen Zeitung El Pais teilte er mit, an einem Theaterstück und an einem großen essayistischen Werk zu arbeiten. Er sagte: „Mir fehlt es nicht an Projekten, sondern an Zeit.“