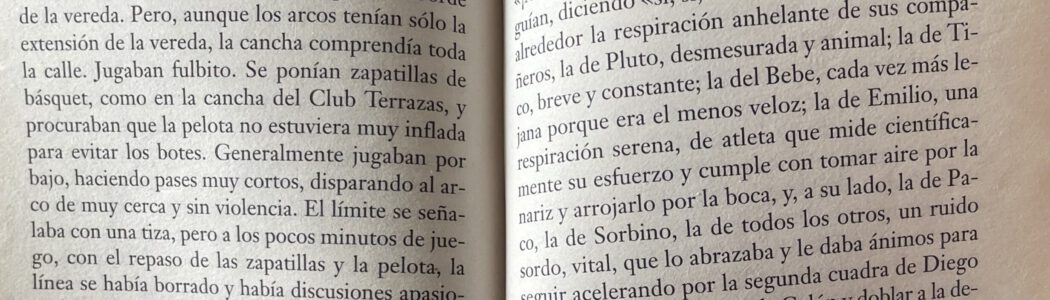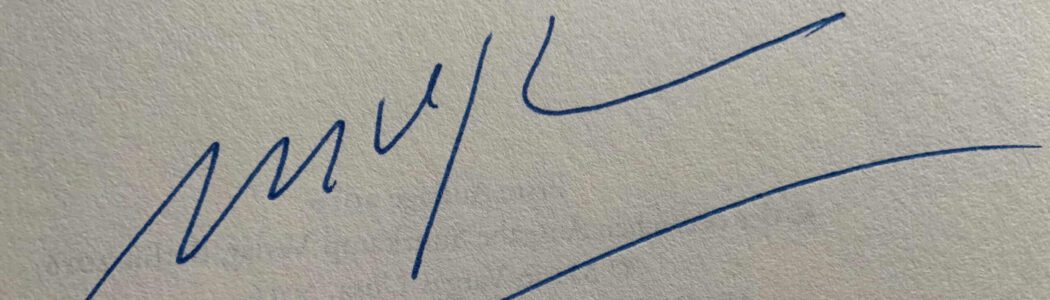Obwohl sich Vargas Llosa beim eigenen Schreiben von Gedichten abgewandt hat, um sich auf Prosa konzentrieren, rückt in seinem universitärem Literaturstudium ein Lyriker in den Mittelpunkt: der Nicaraguer Rubén Diarío (1867-1916). Er habe diesen wie andere Modernisten zunächst „für einen geschwätzigen Dichter gehalten, dessen verbales Feuerwerk mit seiner Musikalität und seinen französisch beeinflussten Bildern keinerlei Tiefe verbarg“, doch durch ein Seminar, dass er 1956 bei Luis Alberto Sanchez besucht, habe er Darío als Begründer der modernen spanischen Dichtung kennengelernt, „ohne dessen mächtige sprachliche Revolution so ungleiche Gestalten wie Juan Ramón Jimenéz und Antonio Machado in Spanien und Vallejo und Neruda in Hispanoamerika undenkbar wären“, erinnert sich Vargas Llosa (FW S. 504). Und als Leser bekennt der Romancier: „Im Unterschied zum Roman, einer Gattung, bei der ich eine unüberwindliche Schwäche für den sogenannten Realismus habe, ist mir in der Dichtung immer die verschwenderische Irrealität lieber gewesen, besonders, wenn sie mit einem Funken Kitsch und Musikalität einhergeht“ (FW S. 589).
Über „Grundlagen für eine Interpretation von Rubén Diarío“ legt Vargas Llosa 1958 sein literaturwissenschaftliches Examen an der San-Marcos-Universität in Lima ab, um dieses Thema in Madrid zu einer Doktorarbeit auszubauen. Er vollendet das Vorhaben aber nicht. Zum einen nutzt er den Zugang zu den Schätzen der Bibliothek an der Complutense lieber, um Ritterromanen aus dem Mittelalter zu lesen, nachdem er in Lima Tirant lo Blanc entdeckt hat. Zum anderen arbeitet er an seinem ersten eigenen Roman über die Erlebnisse an der Kadettenanstalt, die er 1950 und 51 besucht hatte. Er beginnt damit auf der 18-tägigen Schiffspassage von Südamerika nach Spanien im Juli/August 1958. Morgens sitzt er an Deck neben dem Pool, um sich Notizen zu machen, abends wählt er die interessantesten Ideen aus, um sie auf Karteikarten oder mehreren Seiten ausführen, beschreibt seine Frau Julia, die ihn nach Europa begleitet, den Beginn dieses Werks9. Er wird es drei Jahre später mit zunächst mit dem Titel Los Impostores (Die Schwindler), später La ciudad y los perros (Die Stadt und die Hunde) abschließen. In Madrid besucht er vormittags „mit einer gewissen Lustlosigkeit“ die Dokorantenseminare10 und arbeitet jeden Nachmittag in einer rauchgeschwängerten Kneipe an dem Roman, so wie er auch in Paris, wohin das Paar Ende 1959 zieht, an Orten wie dem Café de Flore oder dem Café Le Tournon an seinen Werken strickt.
Als einen Bohèmien im Kaffeehaus soll man sich ihn aber nicht vorstellen. Die Zeit, die ihm Studium und Broterwerb zum literarischen Schreiben übriglassen, nutzt er konzentriert. In Europa habe er gelernt diszipliniert zu arbeiten. Zudem entwickelt er in Anlehnung an Sartre eine „voluntarischste Theorie“ des Roman-Schriftstellertums, zu dem man nicht durch schicksalhafte Bestimmung, sondern durch Willensentscheidung kommt. „Die Inspiration existiert nicht. Sie war etwas, das vielleicht die Hände von Bildhauern und Malern führte und Dichtern und Musikern Bilder eingab, aber den Romancier besucht sie niemals. Er war das Stiefkind der Musen und dazu verurteilt, die verweigerte Zusammenarebit durch Härtnäckigkeit, Arbeit und Geduld zu ersetzen. Es blieb mir keine andere Wahl, denn wenn die Inspiration für die Romanciers existierte, dann würde ich niemals einer von ihnen sein. Nie überkam mich diese göttliche Kraft, jede niedergeschriebene Silbe kostetete mich gewaltige Anstrengung (…) Niemand wird als Schriftsteller geboren, man wurde Schrifsteller, auch in der Literatur wählte man, was man sein wollte (GR 55)“. Die Entscheidung, Schriftsteller zu werden, die Vargas Llosa in Madrid 1958 endgültig fällt, ist demnach von derselben Art wie die für einen bürgerlichen Beruf. Und ebenso sehr ähnelt sich die Arbeitweisen: Seinen ersten Roman habe er über drei Jahre „ohne Inspiration, mit weiter nichts als Beharrlichkeit und Schweiß“ geschrieben, vor allem am Anfang sei es ihm schwer gefallen, „die Bürostunden zu respektieren, die ich mir auferlegte, so viele Stunden vor der Schreibmaschine sitzen zu bleiben, auch wenn ich nicht eine Zeile schrieb“ (GR 55). Die einzige Erleichterung habe daran bestanden, nachmittags in der Kneipe die Aufschriebe zu korrigieren.
Der Roman entsteht in drei Phasen: Zuerst entwickelt der Autor das Geschehen, Charaktere, Fakten usw. in einer ungeordneten Rohfasssung, bevor er dieses „Magma“ strukturiert, indem er Szenen auswählt und ihre Abfolge, die von der wirklichen Chronologie abweicht, um die Neugier und Aufmerksamkeit des Lesers zu steigern und Wahrscheinlichkeit herzustellen, festlegt. Vorbild für diese Wirkung sind die Werke Williman Faulkerns. Die Organsiation der Zeit und die Bestimmung der Erzählinstanz hält Vargas Llosa für die wichtigsten Punkte bei der Romankonzeption. Schließlich gilt es, den Text sprachlich zu optimieren. Hier steht Gustave Flaubert Pate, dessen Madame Bovery Vargas Llosa bei seinem ersten Paris-Aufenthalt begeistert: Der französische Romancier öffnete ihm die Augen dafür, dass eine realistische Erzählung mit sprachlicher Schönheit, Harmonie und Eleganz vereinbar ist. Flauberts Forderung, das treffende Wort zu finden (‚le mot juste‘), versucht er, akribisch zu befolgen. 11 In Flaubert erkennt Vargas Llosa zugleich den Dichter, der sich seiner Berufung voll und ganz hingibt.
Die erste der genannten Arbeitsphasen ist die härteste, weil sie stets mit Zweifeln daran begleitet ist, ob die Geschichte überhaupt trägt – Vargas Llosa nennte es ist ein Kampf gegen die Demoralisierung12. Doch auch nach der Vollendung seines ersten Romans 1961 stellt sich keineswegs ein Hochgefühl ein: Er habe sich krank gefühlt und Widerwillen gegen die Literatur empfunden. Paradox wiederum ist seine Reaktion: „Ich erdachte daraufhin den Plan – eine mekwürdige Therapie –, zwei Romane gleichzeitig zu schreiben. Ich nahm an, es sei weniger beängstigend, zwei zu schreiben als einen einzigen, weil das Wechseln vom einen zum anderen erfrischend, verjüngend sein würrde. Ein äußerst schwieriger Irrtum: es war umgekehrt. Statt nachzulassen, verdoppelten sich der Kopfschmerz, die Probleme, die innere Unruhe“ (GR 56). So sehr Vargas Llosa betont, sich der Literatur verschrieben zu haben, so auffällig ist, dass er den Schaffensprozess, zumindest bei seinem Romandebüt, als etwas Quälendes, Uninspiriertes skizziert und für die Literatur als Kunst eine wenig schmeichelhafte Metapher findet: Sie sei wie ein Bandwurm, den man zu ernähren hat. 13 Die Passion, ein Parasit.
Sein Doppelprojekt entspringt zum einen der Jugend in Piura mit dem Viertel Mangachería und dem legendären wie verrufenen Etablissement vor den Toren der Stadt, zum anderen der Expdition in den peruanischen Urwald am Marañón, die der Student 1958 unternommen hatte. Nach wenigen Wochen oder Monaten parallelen Schreibens an beiden Strängen beginnen sich diese in seiner Fanatsie zu verweben und schließlich zu einem Werk verschmelzen, nämlich La Casa Verde (Das grüne Haus). Insgesamt scheint dieser, ebenfalls derijährige Schreibprozess nicht mehr nur aus Mühsal bestanden zu haben, inbesondere was den einen Teil angeht: „Ich arbeitete diszipliniert und mit einem Enthusiasmus, der niemals nachließ“. (…) Es bereitete mir nicht die geringeste Schwierigkeit, Piura heraufzubeschwören. Ich brauchte nur die Augen zu schießen, und schon sah ich seine engeen Straßen vor mir, die hohen Bürgersteige, die Häuser mit breiten, vergitterten Fenstern, hörte den wie hüpfenden, eingehenden Singsang seiner Bewohner“ (GG 66). Die Begebenheit im Urwald zu imaginieren, kostet hingegen „gewaltige Anstrengen“, weil der Autor nicht aus einem biographischen Fundus schöpfen kann. Um den Mangel zu kompensieren, verschlingt er ein Jahr lang alles, was sich in Bibloheken und Buchhandlungen an Amazonas-Literatur finden lässt, und sucht wöchentloch den botanischen Garten von Paris auf, um sich Bäume und Blumen der Urwaldregion anzusehen. Allerdings habe ihn die Lektüre teilweise obskurer Darstellungen Amazoniens „gegen das Laster der Beschreibung“ geimpft, sodass er in seinem Buch nur einen einzigen Baum beschreibt, den er zudem gar nicht in Paris betrachtet hat (GG 68 f.).
Mit dem Schreiben seines Romans über die Kadettenanstalt, die wegen der Heterogenität ihre Schüler als Miniaturbild der peruanischen Gesellschaft taugte, lernt Vargas Llosa, dass er ein realistischer Schriftsteller sein will, das heißt eine Literatur schaffen, welche die Wirklichkeit nachahmt. Doch darf man reale Missstände als Stoff zum fantasievollen Schreiben nutzen? Der heranwachsende Künstler findet die Antwort und Legitimation bei Jean-Paul Sarte, der in seinem Essay Was ist Literatur? von 1947 darlegt, dass Dichtung eine Art sei, am Wandel mitzuwirken, weil sie Ideen verbreitet und diese wiederum wirtschaftliche, gesellschaftliche oder kulturelle Veränderungen auslösen. Inwieweit Sartres These stimmt, lässt sich schwer nachweisen; Vargas Llosas Erstlingsroman schlägt immerhin in seinem Heimatland hohe Wellen bis ins Militär. Die Leitung des Kadetteninternats nimmt das Werk erbost auf und angeblich soll sie im Herbst 1964 auf dem Schulhof eine Bücherverbrennung veranstaltet haben. Ob dabei tausende Exemplare vernichtet wurden 14 oder vielleicht nur wenige oder ob das Ganze eine Legende ist15, darüber gehen die Berichte auseinander.
Vargas Llosa entwickelt in den 1960er und frühen 70er Jahren seine eigene Theorie darüber, wie Literatur und Wirklichkeit aufeinander bezogen sind. Sie ist disharmonisch und antagonistisch, ja agressiv. Der Schrifsteller lebt demnach aufgrund biographischer Erfahrungen in Unzufriedenheit mit der Welt, weshalb er gegen sie anschreibt. Hierbei protestiert er nicht nur gegen die Realität, sondern spürt auch den Gründen seiner Aversion nach. Den literarischen Gegenentwurf schafft er, indem er sich am Material der negativ empfundenen Wirklichkeit bedient, sie plündert wie ein Aasgeier, um die Teile neu zusammenzusetzen und ihnen aus seiner Fantasie Elemente hinzufügen (elementos añadidos). Die Hinzufügung ist notwendig, damit die wirklichen Begebenheiten in der Erzählung lebendig werden.16 Die höchstpersönlichen Erfahrungen werden dadurch bedeckt und verwandelt, was Vargas Llosa mit einem „umgekehrten Striptease“ vergleicht. Bestimmt wird die Auswahl der realen Inhalte von „Dämonen“, also Obsessionen, die den Schriftsteller umtreiben und quälen, seien sie mit Personen, Geschehnisse, Mythen oder Träumen verbunden. Während die Themenfindung somit irrational erfolgt, beruht die Form auf bewusster Entscheidung.17 Ziel ist, der disparaten Realität eine geordnete Fiktion entgegenzusetzen, die idealerweise alle Seiten des Lebens als ein „totaler Roman“ umfasst. Nach der Stadt und die Hunde und dem Grünen Haus ist Vargas Llosas dritter Roman Das Gespräch in der ‚Kathedrale‘ auf eine solche Totalität ausgelegt, wohingegen die nachfolgenden Werke thematisch und konzeptionell enger geführt sind. 18 Theoretisch entwickelt er die Idee, dass der Romanautor die Wirklichkeit destruiert (und insofern Gottesmord begeht), um aus den Bestandteile eine eigene zu konstruieren Anfang der 70er Jahre in seiner Dissertation über García Márquez (Historia de un Deicidio).
Die Fiktion bietet dem Schriftsteller wie dem Leser einerseits die Möglichkeit, der Wirklichkeit zu entfliehen, andererseits stachelt sie die Unzufriedenheit und den Wunsch nach Veränderung der wirklichen Verhältnisse an. Insofern kann sie politisch subversiv sein. Dennoch dient sie, als ewiger Rebellion, nie anderen Zwecken, sondern immer nur sich selbst, was Vargas Llosa in seiner „Literatur ist Feuer“-Rede, in der er Kuba als Vorbild preist, betont. Für ihn ist das politische Engagement abgetrennt vom Literatur-Schöpfer in der Rolle des öffentlichen Intellektuellen.19 Während seines Europaaufenthalts pflegt er Kontakt mit Unterstüztern der kubanischen Revolution; die perunaische Ehefrau von Che Guevara, Hilda Gadea, und später dessen Mutter Celia sind bei Vargas Llosa und Julia Urquidi in Paris zu Gast. Als Nachrichtenredakteur reist er 1962 erstmals zu der Karibikinsel. Fidel Castros Regime, das eine Diktatur beseitigt hat, die Massen zu beteiligen verspricht und Künstler materiell unterstützt, scheinen ihm wie vielen Intellektuellen als Vorbild. Vargas Llosa nimmt ebenso Anteil an den politischen Debatten und Dissidentenbewegungen im Frankreich der Ära von Charles de Gaulle. Mit Sarte und Simone de Beauvoir sitzt einmal auf dem Podium einer Veranstaltung in der Pariser Mutalité und referiert über die Militärdiktatur in Peru. Weil er Flugblätter der algerischen Befreiungsorgansiation FLN aufbewahrt, gerät er ins Visier der Polizei.
Weltanschaulich steht Vargas Llosa weiterhin links, auch wenn er vom Liberalen Raymon Aron, dessen Artikel er im konservativen Figaro liest, beeindruckt ist. Ein fünftägiger Moskau-Besuch im Mai 1968 führt ihm allerdings die Unfreiheit und Verwahrlosung im sozialistischen Alltag vor Augen.20 Im August folgt die Invasion sowjetischer Panzer in der Tschechoslowakei, ein Gewaltakt, den Fidel Castro zur Enttäuschung seines Anhängers gutheißt. Mit dem karibischen Revolutionär bricht er 1971, nachdem der kubanische Schriftsteller Herberto Padilla wegen moderater Kritik an der Kulturpolitik verhaftet und zu einer öffentlichen Selbstbezichtigung gezwungen wird. Vargas Llosa initiiert einen Protestbrief an Castro, den 61 Autoren unterzeichnen, nicht aber der García Márquez. Die beiden Exponenten des Booms lateinamerikanischer Literatur entfernen sich voneinander und unter den Interessierten an dem Kontinent bilden sich ein pro-kubanisches und ein kubakritisches Lager. Mit der Abkehr von Kuba schwenkt Vargas Llosa zum Liberalismus um, jedoch geht „diese Entwicklung undeutlich und in unsicheren Orientierungsversuchen vor sich“, konstatiert der Romanist Thomas M. Scheerer, der bei Vargas Llosa in den 70er Jahren eine Art „Trauerarbeit“ über den Verlust der früheren Begeisterung erkennt.21 Spätestens Anfang der 80er Jahre hat sich Vargas Llosa zum Liberalen gewandelt. An die Stelle von Jean-Paul Sartre, der ihm in jungen Jahren eine Offenbarung war, tritt dessen Antipode Albert Camus; und hatte der peruanische Schriftsteller 1963 noch von Paris aus das Grab von Karl Marx in London aufgesucht, reist er nun ins schottische Kirkcaldy, wo Adam Smith sein Hauptwerk „Wohlstand der Nationen“ verfasste, und nach Edingburgh, um einen Blumenkranz in der Kirche niederzulegen, wo der Vordenker des Wirtschaftsliberalismus begraben liegt. Seine neuen Vorbilder werden zudem die liberalen Denker Friedrich August von Hayek, Karl Popper und Isaiah Berlin, die er 1979 während seiner Zeit als Gastschriftsteller an der Smithsonian Institution in Washington rezipiert, sowie – in der politischen Praxis – die britische Premierministerin Margret Thatcher.22