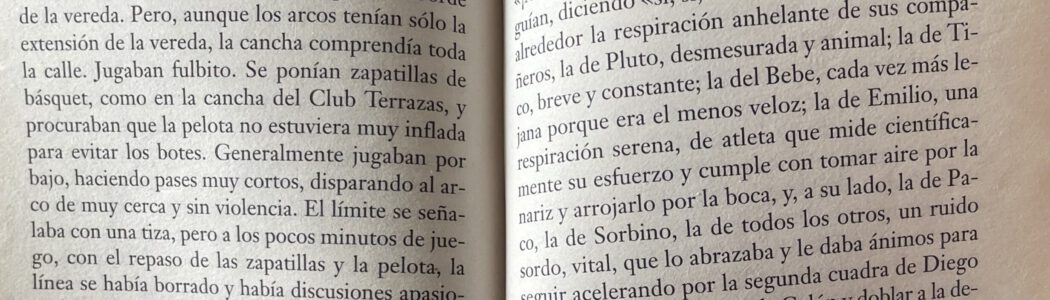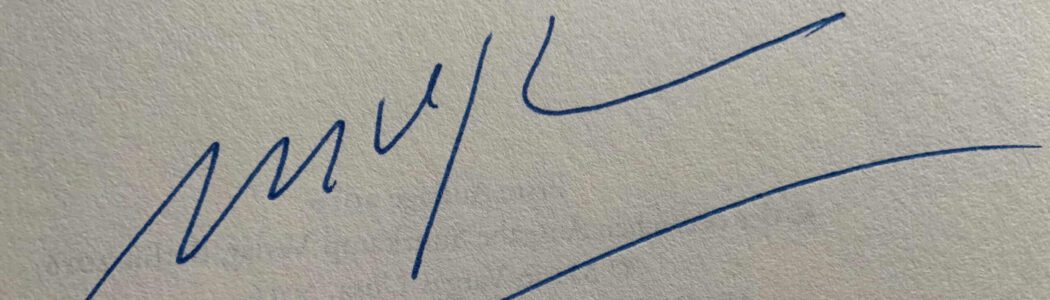Die Stammbäume der Eltern reichen nach Spanien. Die Llosas, also der Zweig der Mutter, sind in der südperuanischen Kolonialstadt Arequipa beheimatet, seitdem sich im späten 17. Jahrhundert dort der im Baskenland geborene Feldherr Don Juan de la Llosa y Llaguno niedergelassen hat. Das doppelte „L“ im Namen könnte auf ferneren katalanischen Ursprung hindeuten, während die Vargas-Ahnen väterlicherseits wohl aus der Provinz Extremadura im Gefolge des Konquistadors Francisco Pizarro nach Peru kamen.1
Vom aristokratischen Rang und Reichtum stieg die Familie Llosa binnen 200 Jahren in die Mittelschicht ab. Als Mario Vargas Llosa geboren wird, arbeitet sein Großvater Pedro für Hacienda-Besitzer, eine Familie namens Said, und hat bescheidene Einkünfte. Im Auftrag der Saids führt er in deren Ländereien in Camaná und später in Saipina bei Santa Cruz (Bolivien) den Baumwollanbau ein. Die Großmutter Carmen sowie ihre mit ihr lebende Kusine Elvira stammen aus Tacna im Südzipfel Perus. Habituell und von den gesellschaftlichen Verbindungen her wirkt die hohe Herkunft der Llosas aber nach. Seinen Onkel Eduardo, einem Richter, beschreibt der Schriftsteller so: „Er lebte, umsorgt von seinem Dienstmädchen Inocencia, wie ein spanischer Provinzadeliger: tadellos gekleidet, methodisch, alterte er inmitten uralter Möbel, uralter Porträts und uralter Gegenstände.“2 Für das Kapital an Beziehungen spricht, dass ein Verwandter peruanischer Botschafter in Bolivien und ab 1945 Präsident Perus ist. Der Großvater wird dadurch Präfekt in Piura, nachdem er in Cochabamba nebenberuflich als peruanischer Konsul fungierte. Hoch dotiert waren diese Staatsämter jedoch nicht. In Cochabamba wird zum Schluss „aus Kostengründen“ das Konsulat ins Privathaus verlegt.3 Von dem Einkommen zehrt eine über zehnköpfige Sippe: Bei den Großeltern Pedro und Carmen Llosa leben nicht nur die Mamaé genannten Großtante Elvira, Mario und seine Mutter Dora, sondern auch deren Brüder Juan, Lucho, Jorge und (zeitweise) Pedro, teilweise mit Partnerinnen (Laura und Gaby) und Kindern (Nancy, Gladys und Wanda) sowie zwei Adoptivkinder (Joaquín und Orlando) und mindestens drei Hausangestellte. Mit der Rückkehr nach Peru teilt sich diese Schar allerdings in verschiedene Haushalte in Lima und Piura auf.
Auf väterlicher Seite stammt der Großvater Marcelino Vargas Andradè aus Chancay, einem im Vergleich zur stolzen Stadt Arequipa unscheinbaren Küstenort bei Lima. Er wird Funker (ein Beruf, den er seinem Sohn vermittelt) und ist schon von Kindesbeinen an für einen Oppositionellen entflammmt: Mit den Partisanen von Nicolás de Piérola zieht er 1895 in Lima ein, später unterstützt er den Caudillo Augusto Durand Maldonado, weshalb er Präfekt in Huánuco wird, bevor man ihn nach Ecuador deportiert. Seine Ehefrau Zenobia, ebenfalls eine Maldonado, hat ihre fünf Kinder (drei starben nach der Geburt) „bis aufs Blut“ geschlagen, wenn sie unartig waren.4 Nach ihrem Tod heiratet Marcelino Vargas Constanza Serpa bei Huancevelica in den Anden, wird Bahnhofsvorsteher und bekommt mit ihr neun Kinder.5 Dafür hat ihn sein Sohn aus erster Ehe und Vater von Mario Vargas Llosa, Ernesto Vargas, verachtet, so berichtet es der Schriftsteller.6
Doch Ernesto Vargas lehnt auch die Llosas ab, obwohl er eine von ihnen ehelicht. Vargas Llosa diagnostiziert bei seinem Vater „Ressentiments und Komplexe, aus denen die Psyche der Peruaner besteht“. Die Llosas seien in seiner Vorstellung zu dem geworden, was er nie gehabt oder was seine Familie verloren habe: Stabilität eines bürgerlichen Heims, das feste Gefüge der Beziehungen mit anderen, ähnlichen Familien, den Bezug auf eine Tradition und soziale Unterscheidungsmerkmale.7
Aus solchem Fundus kann der Vater nicht schöpfen. Überblickt man seinen Werdegang, so tritt ein hartnäckiger, asketischer und weltläufiger, aber auch angestrengter Aufsteiger hervor. Aus dem Hilfsfunker bei der Post wird ein fließend englisch sprechender Angestellter in der Luftfahrt, Statthalter einer amerikanischen Nachrichtenagentur in Lima und Grundstücksentwickler. Er trinkt und raucht nicht, Radiohörspiele sind seine einzige Zerstreuung am Abend. Anders als die tiefkatholische Llosa-Sippe macht er sich nichts aus der Kirche (sein Vater ist ebenfalls antiklerikal), er liiert sich mit einer deutschen Protestantin und bekommt mit ihr zwei Söhne, von denen einer an Leukämie stirbt und der andere Anwalt in Los Angeles wird. Er bewundert die Vereinigten Staaten und zieht 1958 ebenfalls in die kalifornische Metropople. Im Gegensatz zum bibliophilen Llosa-Haushalt hält er schöne Literatur und damit die Ambitionen seines Sohns für unnütz oder gar dekadent. Erst als dieser berühmt ist und im Time Magazin steht, ändert er diese Sicht. „Doch da war es zu spät“, wie Vargas Llosa einmal sagt.8 Deutlich wird an der Vita des Vaters aber auch, dass die Komplexe, die ihm sein Sohn gegenüber der Familie Llosa unterstellt, allenfalls in kultureller, nicht in ökonomischer Hinsicht bestanden haben dürften. Und vielleicht nicht einmal das: Nach seinen moralischen Maßstäben könnten die Verhältnisse in der Familie, beispielsweise dass drei der vier Söhne von Pedro Llosa keinen Beruf erlernen, Frauenhelden sind und noch als Erwachsene von ihm ernährt werden müssen, als liederlich erscheinen.9 Selbst in der Darstellung Vargas Llosas bekommt das Familienbild Risse, wenn er für die Zeit nach 1952 von Alkoholexzessen seines Onkels Juan und fortgesetzte Ehebrüche seines Onkels Jorge berichtet.10
- So zumindest Hans-Jürgen Schmitt: Mario Vargas Llosa, Text+Kritik, 2013. S. 11 f. Eine Genealogie der Llosas seit dem 17. Jahrhundert findet sich hier. ↩︎
- MVLL: Gegen Wind und Wetter. Literatur und Politik, Suhrkamp, 1998, S. 8. ↩︎
- Extemporáneos: Semilla de los sueños. ↩︎
- MVLL: Der Fisch im Wasser, 1998, S. 13. ↩︎
- Hildebrandt en sus trece. 2012, zitiert nach Herbert Morote. ↩︎
- MVLL: Der Fisch im Wasser, 1998, S. 15. ↩︎
- Ebenda. ↩︎
- Interview mit Zeit magazin, 2011. ↩︎
- Das „manichäische Bild“, das Vargas Llosa in seiner Erinnerungen von den beiden Familienzweigen zeichnet, bezweifelt daher Herbert Morote: Vargas Llosa cual tal, Fundacion Kuxta, 1996. ↩︎
- MVLL: Der Fisch im Wasser, S. 324 f. ↩︎